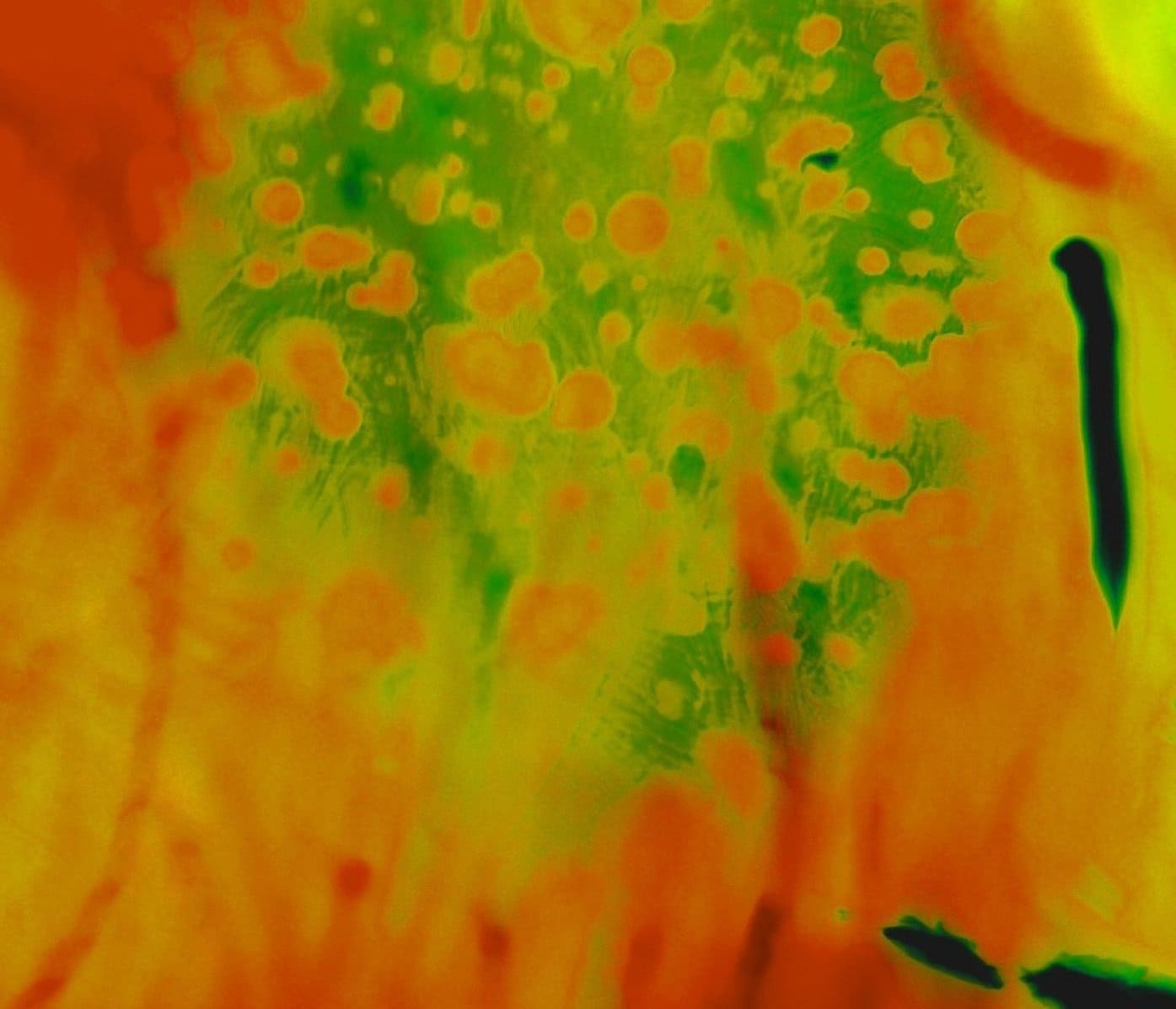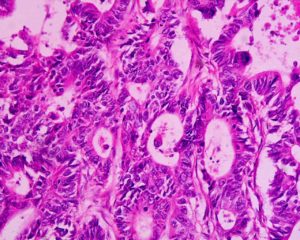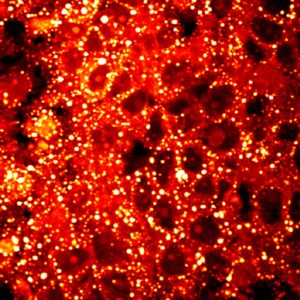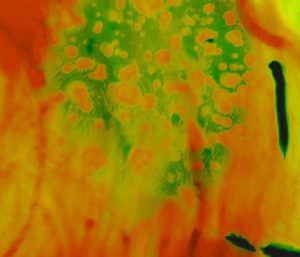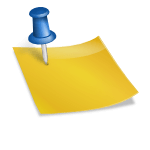Lungenkrebs ist ein Paradebeispiel für eine multikausale Erkrankung, bei der zahlreiche Faktoren und Risiken zusammentreffen müssen, damit es zu einem Krankheitsausbruch kommt. Meist handelt es sich um einen Mix prädisponierender, angeborener Gene(Krebsgene), einer bestimmten Lebensweise und/oder Umwelteinflüsse. In der Gesamtheit ergibt die Gesamtheit der einzelnen Risikofaktoren ein Risikoprofil, das individuell sehr unterschiedlich ist. Risikofaktoren ermittelt man durch die Beobachtung einer größeren Anzahl von Probanden in der Bevölkerung; auf das einzelne Individuum bezogen, sind sie unscharf. Die Feststellung möglicher Risikofaktoren wird u. a. dadurch kompliziert, dass wir nicht wissen, welche Vorlaufzeit Lungenkrebs bis zur Diagnose hat. Viele Experten gehen davon aus, dass die Vorlaufzeit wesentlich länger ist als früher angenommen, und sich – je nach„ Penetranz“ der Krebsgene und der Intensität erworbener Risikoeinflüsse – verkürzen oder verlängern kann.
Warum ist es so wichtig, sein Erkrankungsrisiko zu kennen?
Wer sein eigenes Gefahrenpotential kennt, kann gezielter Präventionsmaßnahmen ergreifen, denn diese sollten bei hohem Risiko
anders aussehen als bei mittlerem oder geringem. Einige der im Folgenden erwähnten Erkrankungsrisiken lassen sich verhindern, zumindest aber abmildern; andere sind nicht oder nur teilweise beeinflussbar. Sehr selten entscheidet ein einzelner Risikofaktor allein über die Gefahr; mehrheitlich ist es die Gesamtheit. Das Fehlen von Risikofaktoren bedeutet nicht, dass man vor Krebs automatisch sicher ist. Andererseits gibt es immer wieder Menschen, die trotz aller Risiken nicht erkranken. Sie sind allerdings die Ausnahme.
Gesicherte, wahrscheinliche und vermutete Faktoren für Lungenkrebs:
- *fortgeschrittenes Alter (gesichert)
- *genetische (angeborene) Veranlagung (wahrscheinlich)
- *familiäre Belastung (gesichert)
- Ernährung (vermutet)
- Immunologische Risiken und Rinflüsse, Infektionen (wahrscheinlich)
- hormonelle Einflüsse (vermutet)
- demographische Risiken und Rinflüsse: Alter, ethnische und geographische Herkunft (vermutet)
- Vor- und Begleiterkrankungen (wahrscheinlich)
- Einflüsse und Risiken von Lebensgewohnheiten, z B. Rauchen (gesichert)
- Übermäßiger Alkoholabusus (wahrscheinlich)
- Passivrauchen (gesichert)
- körperliche Inaktivität (vermutet)
- medikamentös- und strahlenbedingte Risiken (gesichert)
- umwelteinflüsse, Risiken am Arbeitsplatz (gesichert)
- Luftschadstoffe (gesichert)
- psychologische Einflüss (vermutet)
Welche Phasen unterscheidet man bei der Krebsentwicklung?
In der ersten Phase kommt es zu Genmutationen, die je nach Genstärke und zusätzlichen epigenetischen Einflüssen zu einer Entartung von Zellen im Lungengewebe führen (Tumorinitiation). Die mutierten Gene können schon bei der Geburt vorhanden oder im späteren Leben durch karzinogen wirkende Einflüsse entstanden sein. In der zweiten Phase vermehren sich die Krebszellen und infiltrieren das Gewebe (Microenvironment). Tumorpromotoren beschleunigen diese Entwicklung. Der Übergang zur dritten Phase, jener der Krankheitsentwicklung mit Beschwerden, ist fließend. Je nach Einwirkung von Tumorpromotoren kann der Übergang in diese Phase kürzer oder länger sein. In der vierten und letzten Phase verselbständigt sich der Tumor; es
kommt zunehmend zu weiteren Genmutationen im Tumorgewebe, wodurch sich die Aggressivität der Krebserkrankung noch erhöht. In dieser Phase haben epigenetische bzw. tumorschützende Einflüsse von außen kaum noch einen Einfluss. Lediglich medikamentöse, strahlentherapeutische oder operative Interventionen können den Krankheitsverlauf noch aufhalten.
Lungenkrebs ist nicht allein durch genetische Signaturen oder einzelnen Krebszellen definiert, sondern steht und entsteht in einem (patho-)biologischen Kontext des Individuums. Die Reduktion von Krebs auf die Krebszelle gilt heute als obsolet. Im Laufe des Lebens bilden sich bei fast jedem Menschen in der Lunge bösartig entartete Zellen, sei es als Folge von Fehlern in der Genstruktur, durch fehlerhafte Reparaturmechanismen, einer verminderten Apoptose, sei es wegen einer ineffektiven Immunreaktion.
Nur wenige Krebszellen bzw. Krebsvorstufen werden allerdings klinisch relevant und führen zu Beschwerden. Erst dann, wenn Tumorpromotoren hinzukommen, die die Mikroumgebung zugunsten des Zellwachstums beeinflussen oder die Aggressivität des Tumors steigern, werden die Krebszellen und Krebsvorstufen klinisch relevant.
Welche Ursachen führen zur Lungenkrebsentstehung?
Zu den Tumorinitiatoren zählen neben angeborenen Risikogenen, fehlerhaften Reparaturmechanismen und ineffektiven Immunreaktionen im Verlauf des Lebens erworbene Genmutationen. Verursacher hierfür können Viren, Strahlen, O2-Radikale, Giftstoffe, aber auch einfach der Alterungsprozess sein, denn mit zunehmendem Alter nimmt die Gefahr für spontane Mutationen und damit das Krebsrisiko zu. Besonders empfindlich für schädliche Einflüsse ist
die Erbsubstanz während der Zellteilungs- und Verdopplungsphase. Zellen in der Bronchialschleimhaut, die sich häufig teilen, sind daher
anfälliger als andere Zellen. Je stärker die Penetranz der schadhaften Gene und je mehr Reparaturmechanismen beeinträchtigt sind, desto größer ist das Krebsrisiko. Quantitative Zusammenhänge zwischen der Aufnahme mutagen wirkender Substanzen, wie etwa polyzyklischer Amine sowie anderer Schadstoffe im Zigarettenrauch und der Häufigkeit von Lungenkrebs, sind eindeutig. Zwei Typen von Genen sind zu unterscheiden: Onkogene und Tumorsuppressorgene. Onkogene steuern das Wachstum, die Teilung und die Entwicklung von Zellen. Werden sie durch eine Mutation verändert oder ihre Kopienzahl erhöht, kann dies zur Krebsentstehung führen. Tumorsuppressorgene wirken hingegen wie Bremsen; sie kontrollieren die Zellteilung oder lösen einen programmierten Selbstmord schadhafter Zellen aus. Fallen sie aus, sei es durch Mutation oder durch Löschung, entfällt auch die von ihnen ausgehende Kontrolle. Die Folge kann Krebs sein.
Welche Einflüsse erhöhen die Aggressivität von Lungenkrebsvorstufen in der zweiten und dritten Phase der Entwicklung?
Zusätzlich zu den in der ersten Phase im genetischen Code festgelegten biologischen Abläufen und epigenetischen Einflüssen wirken in
der zweiten Phase Tumorpromotoren auf die Aggressivität der Krebszellen und die Widerstandsfähigkeit des Lungengewebes ein.
Im Verlauf des Lebens bilden sich vermutlich bei fast jedem Menschen bösartig entartete Zellen in der Lunge. Dennoch kommt es nur bei wenigen zu einer Krebskrankheit. Ausschlaggebend für die unkontrollierte Vermehrung und Ausbreitung der Krebszellen sind Tumorpromotoren: Hierunter versteht man ungünstige Umwelt-,Ernährungs- und Lifestyle-Einflüsse, bestimmte Hormone und Medikamente, psycho-soziale und soziokulturelle Einflüsse. Auch eine Immunabwehrschwäche wirkt wie ein Tumorpromotor auf die Vermehrung und Ausbreitung der Krebszellen ein.
Wirkt ein Tumorpromotor ohne vorherige Mutationen (Tumorinitiation) ein, so kommt es nicht zu einer Karzinomerkrankung. Wurden jedoch vorher Mutationen ausgelöst, vervielfachen sich die Krebszellen und breiten sich in der Lunge aus. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass weitere Mutationen auf Zellen treffen, die bereitsmit Defekten belastet sind.
Wie werden Substanzen im Hinblick auf eine mögliche Krebswirkung hin untersucht?
Die meisten vor Einführung eines Medikamentes notwendigen toxikologischen Untersuchungen in der Pharmaindustrie – und auch in der Arbeitsmedizin – beschränken sich fast ausschließlich auf mögliche Einflüsse einer Mutagenität (Mutagenitätsuntersuchungen), obwohl Tumorpromotoren für die Aggressivität und Weiterentwicklung der Krebszelle zur Krebskrankheit vermutlich wichtiger sind. Der Hauptgrund hierfür liegt in der Tatsache begründet, dass sich mutagene Auswirkungen leichter überprüfen lassen. Wegen der zahlreichen Interaktionen und der notwendig langen Expositionszeit lassen sich epigenetische Einflüsse auf die Krebsentstehung und Tumorpromotoren auf die weitere Entwicklung zur Krebskrankheit wesentlich schwerer feststellen. Man ist zu deren Überprüfung weitgehend auf Fall-, Kontroll- und Beobachtungsstudien angewiesen. Ähnliche Vorwürfe gelten der Krebsprävention, die bislang sehr einseitig darauf fokussiert war, Mutationen zu verhindern, und die Bedeutung der Epigenetik und Tumorpromotion vernachlässigte.
Hermann Delbrück ist Arzt für Hämatologie – Onkologie und Sozialmedizin sowie Rehabilitation und physikalische Therapie und Hochschullehrer für Innere Medizin und Sozialmedizin. Während seiner Laufbahn in der experimentellen, kurativen und vor allem rehabilitativen Onkologie veröffentlichte er mehrere Lehrbücher. Er ist der Herausgeber zahlreicher Ratgeber für Betroffene mit Krebs. Seit seiner Emeritierung 2007 befasst er sich vorrangig mit Fragen der Prävention von Krebs.