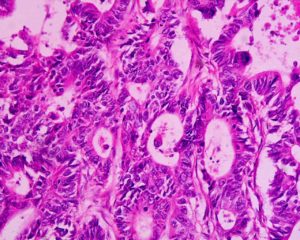Beeinflussung Verhaltens- und umweltbedingte Risiken
Angeborene und verhaltens- sowie umweltbedingte Risiken wirken nicht unabhängig voneinander, sondern beeinflussen sich gegenseitig. Wie stark ein bestimmter Risikofaktor – etwa der Genuss von Alkohol, Tabak oder körperliche Inaktivität – das Erkrankungsrisiko bestimmt, hängt demnach auch von der individuellen genetischen Ausstattung des Betroffenen ab. Forschungsergebnisse der vergangenen Jahre bestätigen, dass neben der individuellen GenAusstattung auch die persönliche Lebensführung bei der Entwicklung von Darmkrebs eine wesentliche Bedeutung haben. Es ist schwierig, bei Verhaltensweisen eigenständige Einwirkungen nachzuweisen und sie, der Bedeutung entsprechend, quantitativ einzuordnen, da zumeist mehrere Einflüsse gleichzeitig stattfinden. So sind adipöse Menschen häufig auch körperlich weniger aktiv; sportlich aktive Menschen hingegen meist gesundheitsbewusster, rauchen und trinken weniger. Einflüsse von Lebensgewohnheiten lassen sich auch deshalb schwer nachweisen, weil sie sich mit der Zeit ändern. Darmkrebs entsteht nicht von heute auf morgen. Vielmehr ist es bis zum Ausbruch ein allmählicher Prozess, der sich über einen langen Zeitraum erstreckt. Welche Gewohnheiten den Tagesablauf vor mehreren Jahrzehnten bestimmten, können viele Befragte nicht mehr angeben. Aber so lange kann die Entwicklung zum Darmkrebs dauern. Es ist unwahrscheinlich, dass bestimmte Verhaltensweisen kurzfristig zu einer Krebserkrankung führen.
Hat die Psyche einen Einfluss?
Optimistische, ausgeglichene und zufriedene Menschen leben besser als Pessimisten, heißt es. Sie ernähren sich gesünder, bewegen sich mehr, rauchen weniger. All das wirkt sich positiv auf die körperliche Widerstandskraft aus und schützt möglicherweise auch vor Krebs. Eindeutige Beweise gibt es hierfür allerdings nicht. Da Stress häufig mit einem nachteiligen Gesundheitsverhalten (häufiger Nikotin- und Alkoholkonsum etc.) assoziiert ist, können sich hierdurch auch Einflüsse auf die Tumorentwicklung ergeben. Insofern können sich Maßnahmen zur Stressbekämpfung positiv auswirken.
Forschungsarbeiten weisen darauf hin, dass Stresshormone chronische Entzündungen fördern, die ihrerseits über eine Anzahl von Faktoren krebsfördernd wirken können. Psychische Stressoren (Ärger, Angst, Wut, Zeitdruck) sowie depressive Stimmungen sollen eine Anzahl von Hormonund Immunfunktionen beeinflussen, die zur Krebsentstehung mit beitragen und die Immunabwehr (Immunosurveillance) hemmen. Chronischer Stress kann indirekt zur Krebsentwicklung beitragen, da sich viele Menschen in Belastungssituationen gesundheitsschädigend verhalten: Sie rauchen mehr, ernähren sich ungesund, trinken mehr Alkohol und schlafen weniger. Damit setzen sie sich mehreren Risikofaktoren aus.
Ist Bewegungsmangel ein Krebsrisikofaktor?
Bewegungsmangel hat einen ungünstigen Einfluss, sowohl auf die Krebsentstehung als auch den Krankheitsverlauf. Es heißt, dass unter allen Tumorerkrankungen, die mit körperlicher (In)Aktivität in Verbindung stehen, Dickdarmkrebs an erster Stelle steht. Für den Enddarmkrebs soll dies allerdings weniger zutreffen. Der für die erhöhte Darmkrebsgefahr verantwortliche biochemische Wirkmechanismus ist unklar. Man geht davon aus, dass körperliche Inaktivität keine Genmutationen verursacht, sondern sich vorwiegend wachstumsbeschleunigend auf die spätere Krebsentwicklung auswirkt und das Mikromilieu für eine Krebsentstehung fördert, also ein Tumorpromotor ist. Völlig unklar ist, weshalb Auswirkungen nur beim Dickdarm-, nicht jedoch beim Enddarmkrebs (Rektumkarzinom) feststellbar sind.
Hat Rauchen einen Einfluss?
Tabakkonsum ist ein Risikofaktor. Bei Rauchern kommt es früher zu einer Polypenbildung und auch zu Krebs als bei Nichtrauchern. Je mehr und je länger geraucht wird, desto höher das Erkrankungsrisiko. Wer 40 Jahre lang raucht, muss mit einer 30 bis 50% höheren Wahrscheinlichkeit rechnen an Darmkrebs zu erkranken. Rauchen beeinflusst auch den Krankheitsverlauf und die Wirksamkeit von Krebsmedikamenten; Therapiekomplikationen sind häufiger, und es kommt frühzeitiger zu einer Metastasenbildung. Der Hauptgrund für die Krebsentstehung sind karzinogene Schadstoffe im Tabakrauch, die zu Genmutationen, so z. B. zu einer Mutation des Tumorsuppressorgens p 53, führen. Kommen zum Tabakkonsum noch andere Risiken hinzu, so können sich diese potenzieren. Infektionen mit humanen Papilloma Viren (HPV) und gleichzeitiger Tabakabusus erhöhen das Krebsrisiko im After. Häufig sind die Adenome im Darm bei Rauchern flacher – und deshalb bei der Vorsorgekoloskopie schwerer zu erkennen. Nachgewiesen ist dies vor allem für den Afterkrebs (Analkarzinom). Einige Studien weisen auf eine spezielle Gefährdung des Enddarms hin. Warum das so ist, bleibt allerdings unklar.
Hat Alkohol einen Einfluss?
Je nach Studie und Region soll bei 10 bis 25% aller in Europa an Darmkrebs erkrankten Männer (und bei 10% der Frauen) Alkohol eine Rolle spielen (Schütze et al. 2011). Zahlreiche Studien weisen auf einen Zusammenhang mit der Häufigkeit von Dickdarmpolypen hin. Polypen sollen bei starkem Alkoholkonsum eher entarten. Weniger der Alkohol selbst als sein Abbauprodukt Acetaldehyd wirkt mutagen und ist somit für ein erhöhtes Erkrankungsrisiko – besonders im Enddarm – verantwortlich. Acetaldehyd schädigt die Erbsubstanz (DNA) und hat sich im Tierversuch als kanzerogen. Die Verträglichkeit alkoholischer Getränke wird u. a. durch die Acetaldehyddehydrogenase bestimmt, ein Enzym, das für den Abbau von Alkohol notwendig ist und dessen Aktivität genetisch bestimmt wird. Bei 40 bis 50% der Ostasiaten liegt eine Mutation dieses ALDH-Gens mit einer extrem niedrigen Aktivität des Enzyms vor, was bei ihnen zu einer erhöhten Konzentration des krebsverursachenden Acetaldehyds im Blut führt und häufigere Krebserkrankungen verursacht, besonders im Mund und den oberen Speisewegen, aber auch dem Enddarm,. Bestimmte Lebensstilfaktoren, wie ungesunde Ernährung oder Rauchen, Entzündungen und Begleiterkrankungen erhöhen die Empfindlichkeit und verändern so die Schwellenwerte. Die Alkoholverträglichkeit ist somit abhängig von der ethnischen Zugehörigkeit, vom Geschlecht, vom Alter, vom Körpergewicht, vom allgemeinen Gesundheitszustand, von Begleiterkrankungen und vielen anderen Faktoren. Einen pauschal geltenden Grenzwert anzugeben, ab dem das Darmkrebsrisiko steigt, ist daher schwierig, ja nach Meinung der meisten Experten unmöglich.
Beeinflusst die Schlafqualität das Darmkrebsrisiko?
Dass Schlafgestörte Leistungseinschränkungen im sozialen Umfeld haben, sie häufiger Unfälle erleiden, mehr Fehlzeiten am Arbeitsplatz haben, ist seit langem bekannt. Neuere Erkenntnisse weisen auch auf ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Diabetes hin. Ob chronische Schlafstörungen jedoch ein Krebsrisiko darstellen, wird kontrovers diskutiert. Gemäß einer größeren retrospektiven Studie haben Personen, die pro Tag weniger als sechs Stunden schlafen, ein um 50% höheres Risiko für Adenome im Dickdarm als Menschen, die sich eines längeren Schlafs erfreuen. Eine zu kurze Schlafdauer soll, nach Ansicht einiger Experten ein eigenständiger Risikofaktor für Darmkrebs sein (Thompson et al. 2011). Andere Experten bestätigen zwar einen Einfluss der Schlafqualität, führen aber die erhöhte Krebsgefährdung auf die häufigere Einnahme von Schlafmitteln und den insgesamt ungesunden Lebensstil von Personen mit Schlafproblemen zurück. Sie vermuten, dass sich eher diese gesundheitsschädlichen Begleitumstände krebsfördernd auswirken. Entscheidend ist wahrscheinlich weniger die Quantität als die Schlafqualität. Unter Schlafqualität versteht man die Aufteilung des Schlafs in seine unterschiedlichen Stadien. Verantwortlich für die Erholung und die Entspannung ist im Wesentlichen die Tiefschlafphase, die nicht zu gering ausfallen darf.
Hat Arbeitslosigkeit einen Einfluss?
Chronische Überforderung und Stress infolge von Arbeitslosigkeit verursachen psychosomatische und psychische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Störungen, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Rückenschmerzen, Angststörungen, Depressionen und Suchtleiden. Direkte Auswirkungen auf die Krebsbildung sind jedoch nicht erkennbar. Indirekt sind Auswirkungen aber wahrscheinlich, da ein mit längerer Arbeitslosigkeit assoziierter Lebensstil häufig Tabak- und Alkoholabusus, körperliche Inaktivität, Übergewicht und einen erschwerten Zugang zu Gesundheitsleistungen mit einschließt (Kreuzfeld et al. 2013).
Erhöhen Mobiltelefone oder elektromagnetische Felder (Elektrosmog) das Krebsrisiko?
Hochfrequente elektromagnetische Felder – zu denen Mobilfunkfelder wie Rundfunk, Fernsehen und Radar zählen – dringen kaum in den Körper ein. Ursache hierfür sind der so genannte Skineffekt und die ausgeprägte Feldabsorption in den oberen Hautschichten. Niederfrequente elektromagnetische Felder, zu denen es in der Umgebung von Stromversorgungstraßen und Elektrogeräten, z. B. der Mikrowelle, kommt (Elektrosmog), können hingegen mit ihrer magnetischen Feldkomponente in den Körper eindringen und dort elektrische Ströme induzieren. Nicht nur die Hersteller von Mobilfunkgeräten, auch das für die Sicherheit und den Schutz des Menschen und der Umwelt vor Schäden durch ionisierende und nichtionisierende Strahlung zuständige Bundesamt für Strahlenschutz (BFS) betonen jedoch, dass „nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu befürchten sind“. Auch die Experten der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) finden keine ausreichenden Beweise für eine Krebsförderung (inadequate evidence if carcinogenicity). Trotz dieser beruhigenden Aussagen äußern sich manche Experten nach wie vor skeptisch. Sie befürchten Langzeitauswirkungen, die mit den bisherigen Testmethoden nicht ausgeschlossen werden können und zu vielfältigen Krankheiten, einschließlich einer Schädigung der Erbsubstanz (DNA), führen können. Ihre Skepsis bezieht sich nicht nur auf Mobiltelefone, sondern auch auf Radaranlagen. Sie argumentieren im Wesentlichen damit, dass einerseits die bestehenden Grenzwerte nichts über mögliche Langzeitwirkungen aussagen und andererseits, dass mit den derzeitigen Untersuchungstechniken erst in vielen Jahren eine endgültige Stellungnahme zu Spätfolgen, einschließlich Krebs, möglich sei. In der Vergangenheit hat man gesundheitliche Auswirkungen von niederfrequenten Feldern negiert. Zunehmend wird jedoch in mehreren, unabhängig voneinander durchgeführten, epidemiologischen Studien über Beobachtungen einer erhöhten kindlichen Leukämierate bei Kindern im Zusammenhang mit niederfrequenten Magnetfeldern in Wohngegenden berichtet.
Quelle und Leseempfehlung zur Darmkrebs-Vorsorge:
Darmkrebs vermeiden (Personalisierte Krebsvorsorge und Früherkennung)
Hermann Delbrück ist Arzt für Hämatologie – Onkologie und Sozialmedizin sowie Rehabilitation und physikalische Therapie und Hochschullehrer für Innere Medizin und Sozialmedizin. Während seiner Laufbahn in der experimentellen, kurativen und vor allem rehabilitativen Onkologie veröffentlichte er mehrere Lehrbücher. Er ist der Herausgeber zahlreicher Ratgeber für Betroffene mit Krebs. Seit seiner Emeritierung 2007 befasst er sich vorrangig mit Fragen der Prävention von Krebs.