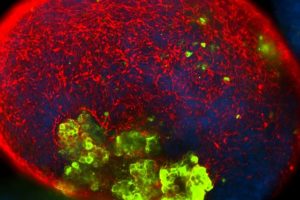Dass die Darmkrebshäufigkeit in den westlichen Industriestaaten in den vergangenen 30 Jahren abgenommen hat, wird nicht nur auf die Einführung von Vorsorge-Früherkennungs-Untersuchungen, sondern auch auf die seitdem gesündere Lebensführung zurückgeführt. Letztere ähnelt dem Lebensstil, der auch zur Prophylaxe von Herz-Kreislauf-Erkrankungen propagiert wird. Ob eine gesunde Lebensführung direkte Auswirkungen auf die Erbsubstanz hat, und so die Entstehung von Krebs verhindert, ist zweifelhaft. Wahrscheinlicher sind Auswirkungen auf Repairmechanismen, vor allem eine Hemmung bereits ausgelöster Krankheitsprozesse. Krebsvorstufen und „schlafende Karzinome“ bleiben bei einem gesunden Lebensstil noch viele Jahre ruhig. Die Aggressivität von Tumorzellen wird reduziert, das Tumorwachstum verlangsamt sich und die Immunabwehr wird verbessert. Im Übrigen schützt ein gesunder Lebensstil nicht nur vor Krebs, sondern auch vor anderen chronischen Erkrankungen und altersbedingten Gebrechen Eine dänischen Beobachtungsstudie bei 160.725 gesunden Erwachsenen wies nach, dass allein die Beachtung von 3 Faktoren in der Lebensführung (mehr körperliche Aktivität, Abbau von Übergewicht, Mäßigung beim Alkoholkonsum) zu einer 24 prozentigen Senkung des Darmkrebsrisikos führt (Kierkegaard et al. 2010). Andere Studien belegen sogar eine Risikoreduktion von 40 bis 50%. Zwischen dem Wissen um eine gesunde Ernährung, der Notwendigkeit körperlicher Aktivität, dem Verzicht auf Tabak sowie der Mäßigung beim Alkoholkonsum und einer Umsetzung im Alltag besteht allerdings eine große Diskrepanz. Anspruch und Wirklichkeit klaffen insbesondere bei Männern weit auseinander. Sie gelten als „Präventionsmuffel“, was möglicherweise mit erklärt, warum sie stärker als Frauen krebsgefährdet sind (www.maennergesundheitsportal.de).
Schützt körperliche (sportliche) Aktivität?
Bei Darmkrebserkrankungen betonte man bislang fast ausschließlich die Ernährung als entscheidenden Einflussfaktor und schenkte anderen Lebensstilfaktoren, wie der körperlichen Aktivität, kaum Beachtung. Dabei behaupten einige Experten, dass körperliche Betätigung das Erkrankungsrisiko ebenso positiv beeinflusst wie die Vorsorgekoloskopie. Diese (schwer zu beweisende bzw. zu widerlegende) Behauptung weist auf die Bedeutung körperlicher Aktivität hin, sollte jedoch auf keinen Fall zu der Schlussfolgerung führen, dass man bei regelmäßiger körperlicher Bewegung auf eine Darmspiegelung verzichten kann. Die Verringerung des Krebsrisikos soll je nach Alter und Körpergewicht 20 bis zu 50% (RR = 0.8 – 0.5) betragen . In vielen Fall-, Kontroll- und Kohortenstudien wurde nachgewiesen, dass sich bei körperlicher Betätigung weniger Adenome/Polypen im Darm bilden, die darüber hinaus kleiner sind und sich weniger aggressiv verhalten. Körperliche Aktivität beugt somit nicht nur Krebserkrankungen vor, sondern hemmt auch den Krankheitsverlauf (RR = 0,5). Insgesamt herrscht die Meinung vor, dass körperliche Aktivität bestehende Tumore nicht beseitigt, sondern die „lediglich“ am Wachstum hemmt. Die Gefahr einer Wiedererkrankung und Metastasierung sei geringer . Erfahrungenzeigen, dass körperlich aktive (stark) Übergewichtige eine bessere Prognose haben als dünne und inaktive Menschen , was darauf hinweist, dass körperliche Bewegung ein größerer Einflussfaktor ist als das Körpergewicht. Die biologischen Mechanismen, die bei körperlicher Aktivität zu einer Abnahme des Erkrankungsrisikos führen, sind noch unzureichend geklärt. Wahrscheinlich ist, dass sich mehrere Schutzfaktoren in ihrer Wirkung addieren, ja möglicherweise sogar potenzieren. Viele Experten weisen dem Insulinspiegel eine hohe Bedeutung bei; die bei körperlicher Aktivität seltenere Insulinresistenz könnte schützen. Diskutiert werden auch epigenetische Effekte. Während körperliche Inaktivität latente Krebsgene aktiviert, würden Bewegung und Sport diese hemmen. Sehr wahrscheinlich hat auch die insgesamt gesündere Lebensführung von sportlich aktiven Menschen eine Bedeutung, da diese im Allgemeinen einen geringeren Alkohol- und Zigarettenkonsum haben, sich bewusster ernähren und seltener übergewichtig sind. Warum die Risikoreduzierung für den Enddarmkrebs (Rektumkarzinom) geringer ist als für den Dickdarmkrebs, ist noch unklar.
Welche körperlichen Aktivitäten sind sinnvoll?
Aus den bisherigen Studien lassen sich nur grobe Empfehlungen ableiten. Hinsichtlich der optimalen Häufigkeit und Intensität, der spezifischen Art körperlicher Art gibt es unterschiedliche Auffassungen. In den meisten Publikationen wird darauf hingewiesen, dass sich alle körperlichen Aktivitäten in Freizeit, Beruf oder Haushalt, mit Ausnahme von Extremsport, schützend auswirken. Freizeitsport wird jedoch besonders positiv beurteilt. Eine Erhöhung der Alltagsaktivität (Treppen steigen anstatt Fahrstuhl fahren, gehen oder Rad fahren anstatt Autofahren etc.) sei jedoch gleichwertig mit Sport, heißt es. Auch körperliche Belastungen im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit sind positiv. Eine Beobachtungsstudie bei Briefträgern würde demnach eine geringere Darmkrebshäufigkeit nachweisen. Es heißt, dass sich das relative Risiko für Adenome und Dickdarmkarzinome bereits bei einer täglichen moderaten körperlichen Aktivität von 30 bis 60 Minuten um 25 bis 50% reduziere (Samad et al. 2005). Jede Steigerung um 4 MET- h/Tag soll mit einer 20% niedrigeren Erkrankungsrate einhergehen (Leitzmann et al. 2008). Regelmäßiges Laufen reduziere die Wahrscheinlichkeit von Adenomen um 16%, die von großen Adenomen sogar um 35%. Regelmäßige körperliche Aktivität in Form von siebenstündigem, zügigem Spazierengehen pro Woche verringere des Erkrankungsrisiko um 40%, schreiben einige Sportmediziner (Halle und Schoenberg 2009). Nach Empfehlungen anderer Experten (Chao et al. 2004) sei mit siebenstündigem, schnellen Gehen pro Woche der gleiche Effekt zu erreichen. Andere Mediziner empfehlen wiederum ein mindestens 30-minütiges schnelles Gehen, Joggen oder Fahrradfahren an mindestens fünf Tagen. Nach Verlautbarungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) soll man mindestens 2,5 Stunden pro Woche Sport treiben. Häufig wird betont, dass man sich so belasten sollte, dass man mindestens dreimal pro Woche für eine halbe Stunde in leichtes Schwitzen gerät.
Was ist besser Krafttraining oder Ausdauertraining?
Es gibt in der wissenschaftlichen Literatur keine eindeutige Empfehlung für eine Ausdauerbelastung oder eher auf Kraft ausgerichtete Aktivitäten. Mit großer Wahrscheinlichkeit beugen sowohl Kraftals auch Ausdauertraining einer Darmkrebserkrankung vor . Aus Sicht der Krebsprävention ist wahrscheinlich das kombinierte Kraft- und Ausdauertraining besonders günstig. Sowohl die körperliche Leistungsfähigkeit als auch die Muskelkraft werden hierdurch verbessert. Für den Erhalt der Mobilität und damit auch der Fähigkeit, sich im Alltag selbst zu versorgen, wird Krafttraining mit steigendem Alter bedeutsamer. Ein zwei- bis dreimal pro Woche jeweils 20 bis 30- minütiges Krafttraining hat positive Effekte auf Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Osteoporose und möglicherweise auch für Krebserkrankungen. Ein wichtiges Argument für Krafttraining ist, dass, neben der Muskelstärkung und der verbesserten körperlichen Leistungsfähigkeit, hinaus vom Muskel verstärkt wichtige hormonell aktive Zytokine in die Blutbahn abgegeben werden. SPARC (secreted protein acidic and rich in cysteine) ist ein solches Zytokin, das – zumindest im Tierversuch – die Tumorentwicklung im Darm hemmt.
Ausdauertraining eignet sich idealerweise zur Prävention von HerzKreislauf-Erkrankungen, wird jedoch auch zur primären Krebsprävention empfohlen. Am häufigsten werden Ausdauersportarten mit kontrollierbaren Dauerbelastungen wie Gehen, Wandern, Laufen, Nordic Walking, Schwimmen, Langlaufski und Radfahren empfohlen; Ballsportarten mit abrupten Spitzenbelastungen sind weniger vorteilhaft. Extreme Ausdauersportarten wie Marathonlauf sind nachteilig. Man unterscheidet Ausdauerbelastungen im aeroben und anaeroben Bereich. Beim aeroben Training geschieht die Zuckerverbrennung zur Energiegewinnung mit Hilfe von Sauerstoff. Anaerob sind Belastungen dann, wenn die Energiegewinnung mit Hilfe von Sauerstoff nicht mehr ausreicht, weswegen Kohlenhydrate ohne Sauerstoff durch Milchsäuregärung in Energie umgewandelt werden. Zur Krebsprävention eignen sich eher aerobe Belastungen. Niedrig- bis mittelgradige Belastungen gehören dazu, da bei ihnen der Stoffwechsel ausreicht, um genügend Energie zur Bewältigung zu gewinnen.
Gibt es empfehlenswerte sportliche Aktivitäten?
Sein Bewegungsprogramm sollte man so auswählen, dass es zu den persönlichen Voraussetzungen und Neigungen passt. Die Gefahr, sportliche Aktivitäten einfach abzubrechen, ist umso größer, je schlechter die Bedingungen, je größer der organisatorische Aufwand, je unangenehmer die Belastungen empfunden werden und je weniger einem die sportliche Aktivität liegt. Bestimmte körperliche Aktivitäten sind eher für Jugendliche, andere für Senioren geeignet. Für den Einen ist Ausdauertraining (Laufen, Schwimmen, Radfahren) besser, für den Anderen Krafttraining. Aus Sicht der Krebsprävention empfehlen sich am ehesten Aktivitäten ohne Leistungsdruck, bei denen sich neben körperlichen Herausforderungen auch psychische und soziale Aspekte integrieren lassen. Optimal ist ein Gleichgewicht zwischen Spannung und Entspannung, zwischen Aktivität und Erholung. Regelmäßigkeit und Dauerhaftigkeit sind Grundvoraussetzung für Gesundheitseffekte. Regelmäßig heißt, dass man mindestens dreimal pro Woche für eine halbe Stunde aktiv ist. Ausdauersportarten mit kontrollierbaren Dauerbelastungen wie Gehen, Laufen, Schwimmen, Radfahren oder auch Fahrradergometerfahren sind wirksamer als Sportarten mit nur kurzen Spitzenbelastungen, wie etwa manche Ballsportarten.
Verrringerung von Alkoholkonsum
Hartnäckig hält sich der Mythos, dass mäßiger Alkoholgenuss – und hier besonders Rotwein – vor Krebs schütze (Kröger 2010). Hierfür gibt es aber keinerlei Nachweise. Wenn überhaupt, so könnten positive Wirkungen von den in alkoholischen Getränken enthaltenen Pflanzenstoffen, nicht jedoch vom Alkohol selbst, ausgehen. Zu den angeblich schützenden Inhaltsstoffen gehören Gerbstoffe, die sich in bestimmten Rotweinen befinden. Sie sollen zu einer Hemmung der Verklumpung von Blutplättchen führen (Thrombozytenaggregation) und somit eine Gewebeinvasion von Krebszellen verhindern. Die stärker im Rot- als im Weißwein enthaltenen antioxydativ wirkenden Polyphenole und Phytooestrogene (Flavonoide, Resveratrol, Querzetin) entfalten in Zellkulturen teilweise eine wachstumshemmende Wirkung; ob dies jedoch auch beim Menschen der Fall ist, ist spekulativ. Der Anteil von Resveratrol im Rotwein beträgt zwischen 0,1 und 15 mg pro Liter (Pinot Noir 3,7 – 8,7 mg/l, Cabernet Sauvignon 0,5 – 4,3 mg/l und Merlot 3,6 – 5,4 mg/l). Bei Weiß- und Roséweinen ist der Gehalt an Resveratrol deutlich geringer, da bei der Herstellung die Traubenschalen entfernt werden. Zu den in Rotwein enthaltenen Inhaltsstoffe, die das Krebswachstum hemmen sollen, gehören auch die Phytooestrogene, die allerdings auch in Zwiebelgewächsen in reichlichem Maße enthalten sind. Ernüchternd für die Weinwerbung ist die Tatsache, dass die angeblich vor Krebskrankheiten schützenden Polyphenole in Zwiebeln, Knoblauch oder Brokkoli in höherer Konzentration als im Rotwein vorkommen. Alkohol enthält nach Fett die meisten Kalorien. Ein g Alkohol liefert etwa 7 Kilokalorien. Ein Liter Bier enthält ca. 470 kcal und eine Flasche Wein (0,75 Liter) je nach Alkoholgehalt bis zu 1000 kcal. Theoretisch ist Wein kalorienreicher, da man in der Regel aber mehr Bier als Wein trinkt, neigen Biertrinker eher zu Übergewicht. Wie bei Lebensmitteln gibt es auch für alkoholische Getränke einen Glykämischen Index (GI). Er zeigt an, wie stark der Blutzuckerspiegel nach dem Genuss von Sekt, Bier & Co. ansteigt. Getränke mit hohem GI-Wert sind: Bier, Gin Tonic, alkoholische Mixgetränke und Alcopops. Je höher der Kaloriengehalt und der Glykämische Index von alkoholischen Getränken, umso höher die Ausschüttung von Insulin ins Blut und die Gefahr einer Gewichtszunahme. Lebensmittel und Getränke mit einem hohen Glykämischen Index sollen auch die Krebsgefährdung erhöhen. Wer abnehmen möchte, sollte dem Alkohol beim Essen entsagen; er sollte auch auf den Aperitif vor dem Essen verzichten, denn Aperitifs regen den Appetit an.
Was ist bei Alkoholabhängigkeit?
Falls Hemmungen bestehen, sich an den Hausarzt zu wenden, kann man spezialisierte Suchtmediziner zu Rate ziehen. Auch gibt es Anlaufstellen wie die der Caritas und Suchtberatungsstellen der Kommunen. Abstinenz ist die beste Entscheidung, lässt sich in der Praxis jedoch häufig nicht ermöglichen. Heute hält man das frühere Dogma einer absoluten Abstinenz nicht mehr für das ausschließliche Ziel einer Behandlung von Menschen mit riskantem Trinkverhalten, sondern sieht auch die Reduktion des Alkoholkonsums auf ein medizinisch und sozial verträgliches Maß als erstrebenswertes und erreichbares Ziel an. Dies auch, weil sich nicht wenige, die zunächst ihren Konsum nur reduzieren wollen, später doch noch für die Abstinenz entscheiden. Nach verschiedenen Studien führt reduziertes und „kontrolliertes Trinken“ bei 40% der Patienten zu einem Trinkverhalten, das im Alltag keine Probleme mehr bereitet. Bei einer Abstinenztherapie sind die Werte nur geringfügig besser. Statt ganz auf Alkohol zu verzichten, lernen die Betroffenen beim kontrollierten Trinken den Konsum einzuschränken und mit Situationen umzugehen, die bisher zum ungehemmten Alkoholkonsum führten. Mit dem Ende einer Therapie – und im Idealfall einer Abstinenz – ist die Alkoholabhängigkeit nicht geheilt, denn die Rückfallgefahr ist für diejenigen groß, die einmal alkoholkrank waren. Auf sich alleine gestellt, erleiden 70% aller Alkoholabhängigen im ersten Jahr nach ihrer Therapie einen Rückfall, im zweiten Jahr trinken sogar 90% wieder. Die Gefahr ist besonders groß, wenn die Betroffenen nach einem Klinikaufenthalt wieder in das gleiche Umfeld geraten und keinerlei soziale Unterstützung erfahren. Hier leisten Selbsthilfegruppen wesentliche Arbeit, in denen sich die Betroffenen gegenseitig unterstützen. Seit vielen Jahren bewähren sich Gruppen wie Anonyme Alkoholiker, Blaues Kreuz, Guttempler oder Kreuzbund. Mit dem Ende einer Therapie, und im Idealfall sogar einer Abstinenz, ist die Alkoholabhängigkeit nicht geheilt, denn die Rückfallgefahr ist für diejenigen groß, die einmal alkoholkrank waren. Auf sich allein gestellt, erleiden 70% aller Alkoholabhängigen im ersten Jahr nach einer Therapie einen Rückfall, im zweiten Jahr trinken sogar 90% wieder. Die Gefahr ist dann besonders groß, wenn die Betroffenen nach einem Klinikaufenthalt wieder in das gleiche Umfeld geraten und keinerlei soziale Unterstützung bei der Abstinenz erfahren. Hier leisten Selbsthilfegruppen wesentliche Aufgaben, indem sich die Betroffenen gegenseitig unterstützen. Seit vielen Jahren haben sich Gruppen wie Anonyme Alkoholiker, Blaues Kreuz, Guttempler oder Kreuzbund bewährt.
Verringerung von Tabakkonsum
Allgemein geht man von positiven Einflüssen bei einem Rauchstopp auf den Krankheitsverlauf aus. Schwelende Krankheitsprozesse verlangsamen sich, die Bösartigkeit von Krebsvorstufen nimmt ab. Bei Exrauchern, die das Rauchen länger als 10 Jahre aufgegeben haben, unterscheiden sich Krankheitshäufigkeit und -verlauf kaum noch von Nie Rauchern. Raucher zählen zu den Risikopersonen, weshalb sie DarmkrebsVorsorge- Früherkennungs-Untersuchungen frühzeitiger (etwa ab dem 40. Lebensjahr) durchführen lassen. Dass Rauchen schädlich und krebsfördernd ist, gehört inzwischen zu den Binsenweisheiten. Die meisten Raucher haben auch mindestens schon einmal einen Versuch zur Abgewöhnung unternommen. Tatsache ist aber, dass die wenigsten überhaupt ein Jahr durchhalten, wenn sie dies ohne Hilfe tun (Breitling et al. 2009). Um die Chancen einer langfristigen Tabakabstinenz zu erhöhen, sind individuelle Empfehlungen notwendig. Der Wille zum Aufhören ist allerdings eine Grundvoraussetzung für den Erfolg. Bei der Tabakabhängigkeit gibt es physische und psychische Ursachen, die über Wahl und Erfolgswahrscheinlichkeit einer Methode zur Entwöhnung entscheiden. Eine psychische Abhängigkeit äußert sich darin, dass das Rauchen zu einer Gewohnheit geworden ist; einer physischen Abhängigkeit liegt hingegen eine starke Abhängigkeit vom Nikotinspiegel zu Grunde. Meist liegen beide Abhängigkeiten in einem mehr oder minder starkem Verhältnis vor, weshalb bei der Entwöhnung auf beide Ursachen eingegangen werden muss. Zusätzlich gibt es viele soziale und soziodynamische Gründe, die bei der Tabakentwöhnung berücksichtigt werden müssen. Genetisch bedingtes und somit schwerer beeinflussbares Suchtverhalten gibt es zwar, ist jedoch die Ausnahme. Bei den meisten Rauchern liegen beeinflussbare Ursachen vor. Rauchern, die das Rauchen aufgeben und Rat und Hilfe in Anspruch nehmen wollen, ist die von der Deutschen Krebshilfe und dem Deutschen Krebsforschungszentrum organisierte Raucher Hotline zu empfehlen (www.tabakkontrolle.de, Tel.: 06221/424224, Mo bis Freitag 14 bis 18 Uhr). Neben einer telefonischen Beratung werden von ihnen Adressen speziell ausgebildeter Kursleiter vermittelt, die in Wohnortnähe Tabak-Entwöhnungskurse anbieten. Eltern greifen später dreimal häufiger selbst zu Zigaretten als Kinder von Nichtrauchern. Nicht allein die negativen gesundheitlichen Auswirkungen des Rauchens, sondern vor allem die positiven Konsequenzen des Nichtrauchens müssen bei Jugendlichen hervorgehoben werden. Jugendliche haben häufig eine größere Angst vor Einbußen ihrer körperlichen (sportlichen) Leistungsfähigkeit und ihres äußeren Erscheinungsbildes als vor erhöhten Krebs- und Herz Kreislauf- Problemen im Erwachsenenalter. Größere Erfolgschancen als Hinweise auf körperliche und intellektuelle Einbußen haben bei ihnen Argumente wie eine bessere körperliche Leistungsfähigkeit, das Gefühl der Unabhängigkeit, finanzielle Einsparungen und eine größere Attraktivität des Nichtrauchens. Wichtig ist eine effektive Tabakprävention in der Jugend, lange bevor es zu schweren Gefäßschäden und Einschränkungen der HerzLungen-Funktion kommt. Die wirksamste Methode, um den Zigarettenverbrauch gerade bei Minderjährigen und den jungen Erwachsenen zu vermindern, ist eine deutliche Erhöhung der Tabaksteuer. Sinnvoll ist, schon in der Grundschule Maßnahmen zur Verhinderung des Rauchens in den allgemeinen Lehrplan aufzunehmen, wobei die Inhalte auf die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen anzupassen sind. Je nach Ursache der Tabakabhängigkeit gibt es bei Erwachsenen verschiedene Entwöhnungshilfen, die deswegen unterschiedlich erfolgversprechend sind.
Quelle und Leseempfehlung zur Darmkrebs-Vorsorge:
Darmkrebs vermeiden (Personalisierte Krebsvorsorge und Früherkennung)
Hermann Delbrück ist Arzt für Hämatologie – Onkologie und Sozialmedizin sowie Rehabilitation und physikalische Therapie und Hochschullehrer für Innere Medizin und Sozialmedizin. Während seiner Laufbahn in der experimentellen, kurativen und vor allem rehabilitativen Onkologie veröffentlichte er mehrere Lehrbücher. Er ist der Herausgeber zahlreicher Ratgeber für Betroffene mit Krebs. Seit seiner Emeritierung 2007 befasst er sich vorrangig mit Fragen der Prävention von Krebs.